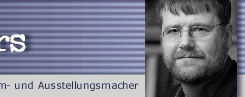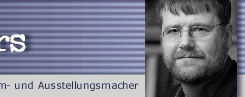|
Hrsg. und gestaltet
von Jens-F. Dwars.
Umschlag und Frontispiz mit Holzschnitten von Martin Max.
40 Seiten, handgeheftet in Pappband, farbiger Schutzumschlag
Einmalige Auflage in 333 num. Exemplaren.
Nr. 1-33 liegt je eine Holzschnitt von Martin Max bei.
Diese Vorzugsausgabe ist zu EUR 29,90
bei Martin
Max erhältlich.
ISBN 978-3-943768-14-5
EUR 12,90 EUR
Zu bestellen
beim Herausgeber.
Der Versuch einer
Selbstverständigung in 18 Erinnerungsfragmenten und einem
lyrischen Epilog.
Christine Hansmann wurde 1961
in einer traditionsreichen Musikerfamilie in Erfurt geboren,
frühzeitig Unterricht in Klavier, Ballett und Gesang.
Nach Abitur Tätigkeit als Krankenschwester und Musikalienverkäuferin,
1983-89 Gesangsstudium in Leipzig, seit 1989 Opernsängerin
am Deutschen Nationaltheater Weimar.
Preise bei Gesangswettbewerben in Deutschland und Tschechien,
zahlreiche Konzertreisen, u.a. nach Japan, New York, Paris,
Israel, Niederlande.
Gastspiele u.a. an den Opernhäusern Leipzig, Dresden,
Zürich, Salzburger Festspiele 1991, in Litauen, Tschechien
und Dänemark.
Seit 2002 Lesungen mit eigenen Texten.
Weitere Informationen unter: www.christine-hansmann.de.
|
|
|
Leseprobe
Es gab den Garten. Er war üppig,
denn so zeigt ihn meine Erinnerung, auf jeden Fall aber groß,
was sich noch heute ohne Mühe beweisen läßt.
Auf der weiten Fläche vor dem Haus durfte mit Ausnahme
eines kleinen, grasbewachsenen Platzes, wo eine Hängematte
zwischen zwei Apfelbäumen schaukelte, nicht gespielt
werden. Es reizte uns natürlich, das Gebot hin und wieder
zu übertreten und den ganzen vorderen Bereich, in dem
Phlox, Cosmea und Kokardenblume in der sommerlichen Hitze
durcheinanderwogten, zu durchstreifen. Aber die Gefahr, entdeckt
zu werden und der unweigerlich folgenden Schimpfkanonade der
Nachbarin ausgeliefert zu sein, war so groß, daß
wir der Versuchung nur selten nachgaben.
Am Haus entlang zog sich rechterhand ein schmaler Weg nach
hinten, der, über eine Steintreppe erreichbar, eine Mannshöhe
tiefer lag und von einer mit Feldsteinen belegten Böschung
begrenzt wurde. Er mündete in eine obstbaumbestandene
Wiese, auf der die Nachbarkinder manchmal im Schutz der Hauswand
ein kleines Zelt aufbauten, ihr winziges Heiligtum, nur auf
Strümpfen und mit besonderer Erlaubnis zu betreten.
Den hölzernen Gartenzaun, der das Grundstück umgab,
durchbrach dort, wo die bebaute Anhöhe sich wieder talwärts
zu neigen begann, eine verschlossene Pforte. Sie führte
in ein angrenzendes Waldstück, das nahtlos in die öffentliche
Parkanlage des Kartausgartens überging.
Es gab den Garten.
Und es gab eine Nacht, eine einzige, die so fühlbar geblieben
ist, als ob nicht mehr als ein halbes Leben zwischen mir und
dem pausbäckigen, scheinbar stämmigen Kleinkind
läge, das ich gewesen sein soll, wenn ich den wenigen
Bildern aus dieser Zeit Glauben schenke.
Aus welchem Grund uns mein Vater damals weckte und durch die
Gartentür in den dämmrigen Park führte, kann
ich nicht sagen. Jedenfalls sehe ich mich barfuß, im
Nachthemd, auf dem vom Abendtau schon feuchten Rasen stehen,
zitternd, mit aufgerissenen Augen, vollkommen gebannt.
Der Wald war schwarz und schwieg. Er schien mir undurchdringlich,
obwohl dort nur einige Reihen Tannenbäume gestanden haben
können, ehe die Parklandschaft begann.
Die Dunkelheit senkte sich herab, ein warmes, samtweiches
Tuch, mit Händen greifbar.
Vereinzelt waren Vogelstimmen zu hören, träumend,
in Schlaf gehüllt.
Aus den Wiesen stieg weißer Nebel. Er blieb zwischen
den Büschen und dem Unterholz hängen, verwischte
die letzten, noch erkennbaren Konturen und tauchte die Szenerie
vollends ins Unwirkliche. Eine Welle aus Furcht und Seligkeit
hob mich empor und spülte mich in einen Taumel hinein,
dem ich mich ohne nachzudenken hingab.
Ein Faun, ein Irrwisch.
Paradieseslust. Vorgeschmack auf künftige Wonnen. Ob
irdische oder himmlische, muß ich dahingestellt sein
lassen.
Mehr ist es nicht gewesen. Ein nächtlicher Garten, mondlichthell.
Ein tanzendes Kind.
Später, vielleicht gegen Mitternacht, wurde es kühl.
Die Presse urteilt:
Sie liegen einfach gut in der Hand, die Bücher der neue
Reihe „quartus-Miniaturen“, fadengeheftet und
sorgsam gestaltet, in einer Auflage von jeweils 333 Exemplaren.
Und man kann nur wünschen, dass diese Reihe in E-Book-Zeiten
noch manche Fortsetzung erfährt. Nichts gegen das praktische,
Wälder bewahrende E-Book. Doch man lese von Fühmann
Pavlos Papierbuch, wo der Held im fernen Jahr 3436 voller
Staunen eines der seltenen, auch weil verbotenen Papierbücher
in der Hand hält „wie einen Leib“, wie ein
lebendiges Wesen, ein Ding „sinnlicher Selbstoffen-barung“.
Freilich, zu einem solchen herausgeberischen Vorhaben müssen
die Inhalte passen, und das ist der Fall.
Schon Christine Hansmanns Titel Dunkelkammer und
eine damit gegebene existenzielle Situation sagt etwas über
das poetische Programm. „Es gab Stille, und es gab die
Dunkelheit. Und es gab dieses Zimmer mit den zugezogenen Vorhängen,
das mir vertraut gewesen war und nun in Stummheit versank.“
Freilich diese „stille Kammer“, „nicht dem
Bann des Tages verfallen“, mag auch an das Fotolabor
erinnern, in dem sich unter besonderer Beleuchtung Bilder
entwickeln. Aber es ist eben auch keine „stille Kammer,
wo ihr des Tages Jammer verschlafen und vergessen sollt“,
wie es im Abendlied von Eduard Claudius heißt, das in
den Texten immer einmal aufklingt. Nein, der Jammer wird nicht
verdrängt. Christine Hansmann gibt in den sechzehn Stücken
keine Erzählungen, man mag eher an Traumsequenzen denken,
an ein „Leben hinter dem Leben“, in dem sich die
äußere Welt, das alltägliche Leben in Bildern
bricht. Der Reiz besteht darin, wie Christine Hansmann das
Reale in dem Phantastischen aufhebt. Und damit kommen existenzielle
Situationen auf ganz eigene Weise ins Bild. Die Ängste
und Albträume, „jene Einbrüche des Schreckens“,
die Sehnsucht nach Liebe, die Schmerzen einer Trennung, die
Ängste vor Sprachlosigkeit. Da gibt es Erinnerungen an
Kindheit und Jugend, da kommt Historisches und Politisches
ganz unaufdringlich zur Sprache, wenn da an ein „Schweigen
im Raum“ erinnert wird. Natürlich ist der Grund
dieser lyrischen Prosa die Erinnerung, oft an Kindheit und
Jugend. Aber sie wird nicht zeitlichen Abläufen unterworfen
und geht schon gar nicht darin auf, etwa Einsichten in einem
Entwicklungsprozess zu formulieren. Wohl aber kommen die Konflikte
zwischen Welt- und Ich-Zuständen zur Sprache, manchmal
einem kommentierenden Gestus mehr als einer lyrischen Verdichtung
vertrauend. „Es ist seltsam, daß geschieht, was
geschieht und trotzdem persönliches Leben möglich
ist.“ In den besten Stücken buchstabieren sich
vor dem inneren Auge die Erinnerungsbilder und der erzählende
Gestus geht nun wirklich in eine lyrische Prosa über.
In dieser Hinsicht ist der fünfte und neunte Abschnitt
besonders gut gelungen. Was die Texte sympathisch macht, ist,
dass sich Christine Hansmann nicht scheut, ihre Konflikte
und Fragen zur Sprache zu bringen und damit zugleich dem Ganzen
eine Offenheit zu geben, die den Leser auffordert das Seine
hinzu zu tun.
Martin Straub, in: Palmbaum, Heft 2/2013
|