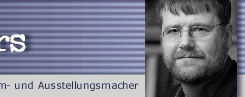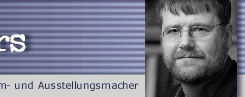Nachwort
Vom
Juckreiz der Bilder
Wenn es stimmt, dass jedes wahre Gedicht ein Geheimnis hat,
das es unergründlich, also unendlich ausdeutbar macht,
dann sind diese Nadelstiche in Schlangensprache wahrhaftige
Dichtung: enigmatisch, wie der Kenner raunt, rätselhaft,
flüchtig wie der Wind, ein Wispern, leise unaufdringlich,
und doch präzise, genau gearbeitet, streng gebaut. Kunstgebilde,
organisch verwoben, eine Komposition aus Worten, die Verborgenes
anrühren. Dem Gesang von Schamanen verwandt, Poesie als
Akupunktur, die in den Nerv der Zeit sticht, um aufgestaute
Energien wieder ins Fließen zu bringen. Oder anders:
Übungen im Heimatmen, Versuche, sich der Wurzeln zu versichern,
der ausgerissenen, in einem schuppigen Land, das sich permanent
häutet.
Da ist von etwas die Rede, das auch die Zeichnerin umtreibt.
Beide gehören einer Generation an: Christian Rosenau,
1980 in Weimar geboren, hat Klassische Gitarre studiert und
lebt als freischaffender Musiker, Musikpädagoge und Lyriker
in Coburg. Ulrike Theusner wurde 1982 in Frankfurt/Oder geboren,
ist in Weimar aufgewachsen und hat dort die Bauhaus-Universität
absolviert. Später ging sie nach Nizza, fand Galeristen
in Paris und New York.
In der DDR geboren, erlebten beide als Kinder den Auf- und
Umbruch, der heute nur „Wende“ heißt, wuchsen
hinein in die Öffnung ins Freie, verkörpern geradezu
dieses Hineinwachsen ins Offene. Eine glückliche Generation,
sollte man meinen. Doch das Offne ist auch das haltlos Ungewisse,
das Andere, wonach sich die Generation ihrer Eltern sehnten,
ohne darauf vorbereitet gewesen zu sein. Diese Glückskinder
sind Erben gescheiterter Träume. Und die Begabtesten
unter ihnen, die mit Feingefühl Geschlagenen, spürten
früh den Verlust im Gewinn: die Hoffnung, die dem zerfallnen
Staat einmal zugrunde lag, die sich in den Drill von Fahnenappellen
verkehrt hatte, in den Pioniergruß, der mit erhobener
Hand eine Furche ins Hirn zog, und dennoch nachhallte im Kinderlied
von der Heimat, die mehr sei als die Städte und Dörfer
...
Diese Generation des Umbruchs ist nirgends zuhaus, weder in
der alten, noch in der neuen Welt, eben weil ihr beide als
fertige Muster übergestülpt wurden, ohne eigene
ausbilden zu können. Sie sind angespült in diese
Zeit, sie wissen, dass die Wurzel ... krank war, sie sahen
1989 auf andere Art hoffnungstrunkene Gesichter mit Kerzen
bewaffnet, und sie erlebten die Erosion jeglicher Autoritäten,
den Zerfall der bärtigen Büsten, die leere Sockel
hinterließen.
Als Musiker spielt Christian Rosenau dieser brüchigen
Welt ihre eigne Melodie in Worten vor, Worte, die an Schnüren
hängen, viel gebraucht, vor Missbrauch nicht geschützt.
Indem er die überkommenen Wörter wie Fremdkörper
behandelt, sie aus gewohnten Zusammenhängen herauslöst
und neu kombiniert, bringt er sie in unverbrauchten Bildern
zum Leuchten: da ist von Augenfell die Rede, von der Fontanelle
des Mondes, den Kiemen der Stadt, von der Klinge des Mittags
und Gedächtnismedusen. Bilder, die sich eingraben, die
als Juckreiz im Leser weiterwirken, als anhaltende Verunsicherung.
Oft melancholisch getönt, doch nie sich im Jammer gefallend.
Und wer hat je so abgründig schön den Raps besungen,
diese fraglos blühenden Landschaften der Agrarindustrie,
die Metastasen der Wachstumsgesellschaft, wo der Wolf ...
durchs Feld zieht und das Rattern immer näher kommt ...
Ulrike Theusner hat als Modell die Glanz- und Kehrseiten der
schönen neuen Glitzerwelt kennengelernt und zeigt beides
in ihren Bildern. Sie illustriert die Gedichte nicht. Bild
und Text erzeugen vielmehr eine spannungsvolle Einheit, die
beide potenziert. So folgen wir gern dem Wanderer, der uns
eingangs ins Offne lockt, um zuletzt seinen eigenen Weg zu
gehn.
Pressestimmen
Wenn Lyrik die Kunst ist, mit
Worten zu musizieren, so trifft dies auf Christian Rosenau
ganz besonders zu. Rosenaus Wort-Kunst lebt vom Klang und
den Bildern, die sie beschwört - oftmals ungewöhnlichen,
verrätselten Bildern, die entschlüsselt werden wollen,
die dazu einladen, hineinzuhören in den Rhythmus der
Silben und Worte.
Jochen Berger, Coburger Tageblatt.
Schlaglichtartig, assoziativ, bilderfrisch tmd sprachfunkelnd
reflektiert Christian Rosenau Erlebtes, Erspürtes, Erträumtes.
Fokussiert die große Geschichte mit dem persönlichen
Teleskop, erzählt zwischen den Zeilen von Aufbruch und
Abbruch, von Hoffnungen und Enttäuschungen und von den
Strategien des Weiterlebens ... bedachtsame, hintergründige,
oftmals verrätselte Poeme, die voller Musikalität
stecken und von einem feinen Sensorium für die Welt zeugen,
... von der Weimarer Künstlerin Ulrike Theusner kongenial
illustriert.
Neue Presse, Coburg
Um es gleich vorweg zu nehmen. Der schmale Band ist
ein Fest für die Sinne und den Verstand. Vielleicht liegt
das an der Doppelbegabung Rosenaus, der Musiker und Dichter
in einem ist. Der Rhythmus seiner Gedichte, ihr musikalischer
Fluss paart sich mit einer sicheren Bildsprache und einem
klaren Aufbau der Gedichte. Sie sind akkurat gearbeitet, nicht
das kleinste Detail wird dem Zufall überlassen. Doch
die Spuren des Handwerklichen sind nicht mehr sichtbar. Es
ist allein der Atem des Lyrikers zu spüren. (...)
Die aufsteigenden Kindheitserinnerungen und frühen Bilder
werden solange beatmet, bis sie Teil der Heimat und des Gedichts
werden. So gelingt Christian Rosenau etwas bislang für
unmöglich Gehaltenes: In seinen Gedichten wird das, was
jedem in die Kindheit scheint und später nicht festzuhalten
ist, eben das, was Ernst Bloch „Heimat“ nannte,
als Bild und Klang manifest.
Im rhapsodisch anmutenden Gedichtzyklus "unsere Heimat"
erzählt Christian Rosenau, wie seine Generation die letzten
drei, vier Jahre der DDR in der Schule, wie sie die Demonstrationen
im Herbst 1989, die deutsche Vereinigung und das Erwachsenwerden
erlebte. Wohl nie zuvor hat ein Lyriker beschrieben,
wie Kinder den Übergang von der geschlossenen in die
offene Gesellschaft reflektiert haben, wie sie mit
den Verunsicherungen ihrer Eltern und Lehrer leben mussten,
wie der Schein der Kerzen in ihnen Hoffnungen weckte, die
nie erfüllt wurden und wie sie bis heute den „Weg
ins Offene“ zugleich als Chance für ein gewinnendes
Leben und als Gefahrenzone empfinden. (...)
In seinen schönsten Gedichten wie "des Regens dünne
Schrift", "im Kiesbett der Silben" und "Aufbruch"
findet er zu einer wundersamen Verschmelzung von „äußerer
und innerer Wirklichkeit“. Diese feine Mischung
von „Realem und Phantastischem“ findet sich auch
in den Zeichnungen der Weimarerin Ulrike Theusner.
Die lyrischen und die gezeichneten Bilder ergänzen einander
spannungsvoll. Sie kommunizieren mit einander. Christian Rosenaus
Nadelstich und Schlangensprache sei allen Lyrik-Freunden wärmstens
empfohlen.
Dietmar Ebert, Palmbaum, Heft 2/2018
Am pointiertesten und kunstvollsten (arbeitet
Rosenau) zweifellos im Zyklus „unsre Heimat“,
der das Ende der DDR und die ersten Jahre der deutschen Einheit
in Form schlaglichtartiger Reminiszenzen der Schuljahre ’86
bis ’95 in Szene setzt. Ohne Verklärung, ohne Lamento
und ohne die Attitüde objektiv-distanzierter Historisierung,
doch nadelspitz in den lakonischen Schlusswendungen, die sich
wie Widerhaken ins Gedächtnis bohren. (...) So
knapp, so gekonnt wird die Sprache des ‚erinnerten‘
Einst und des ‚erlebten‘ Jetzt gesiebt und gesichtet
– mit offenkundiger Freude an der Sache und stets überzeugendem
Ergebnis. Sprachspielerisch etwa in den „Rapsodien“,
zehn wort- und bildgewaltigen Variationen zum Thema Raps:
„Raps, wohin das Auge schäumte, / Raps // und Häuser,
Inseln, Rispenmeere / schimmerten heran, / Dächer, Türme,
Kirchenschiffe / kenterten mit Huhn und Hahn“. Mitunter
aber auch mittels befreiender Komik, so im bitterbösen
„Jagdnotat“: „kein Schuss nur die Axt /
aus der Zunge // mein Kind.“ Komik und Bitternis
verbinden auch die Zeichnungen Ulrike Theusners,
die dem sorgsam ausgestatteten Band beigegebenen sind ....
Überaus passend dazu die bibelschwarze Broschur der Edition
Ornament mit dem dunkelrot züngelnden Lesebändchen.
Buchgestalterisch lässt sich die Luzidität
der Texte kaum wirkungsvoller in Szene setzen –
auch für bibliophile Leser wahrhaft die helle Freude!
Stefan Borchers, Ostragehege (II/2019)
Nächste Lesung
aus dem Buch:
Siehe die Autorenseite.
|
 |